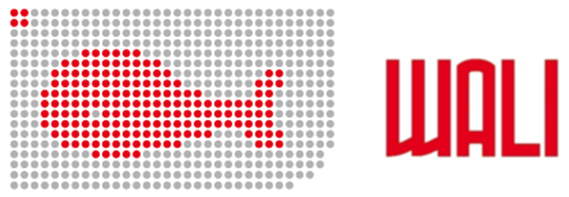Eingliederungsleistungen im Bundeshaushalt 2025 und 2026: Öffentliche Weiterbildung und Qualifizierung sichern
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit (bag arbeit), der Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband), der Evangelische Fachverband für Arbeit und soziale Integration (EFAS), sowie der Verband Deutscher Privatschulverbände (VDP) nehmen Stellung zu den geplanten Haushaltsansätzen für Eingliederungsleistungen und Qualifizierungsmaßnahmen in den Bundeshaushalten 2025 und 2026.
Die Pressemitteilung kann hier heruntergeladen werden.
Jetzt in soziale Sicherheit, ökologischen Fortschritt und gesellschaftlichen Zusammenhalt investieren! Gemeinsamer Aufruf aus Sicht von Wohlfahrtspflege, Gewerkschaft sowie Umwelt- und Sozialverbänden
Mit der ersten Lesung des Entwurfs zum Bundeshaushalt 2025 beginnt der Bundestag die parlamentarischen Beratungen über die politischen Schwerpunkte der kommenden Jahre. Die dabei getroffenen Entscheidungen werden die Beschäftigungs-, Sozial- und Umweltpolitik langfristig prägen und haben unmittelbare Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in unserem Land.
Diese Beratungen finden in einer Zeit statt, in der massive Investitionen in die öffentliche und soziale Infrastruktur sowie den Klima- und Naturschutz dringend erforderlich sind. Der soziale Zusammenhalt ist gefährdet, und die Demokratie sieht sich zunehmenden Anfechtungen ausgesetzt.
Bundestag und Bundesrat tragen die gemeinsame Verantwortung, sozial-ökologische Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren und deutlich zu machen: Äußere, innere, soziale und wirtschaftliche Sicherheit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Unsere Erwartung an die demokratischen Parteien ist klar: Sie müssen in Regierung wie Opposition, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene Verantwortung für die positive Weiterentwicklung unseres Landes übernehmen. Der Bundeshaushalt und die Ausgestaltung der geplanten Sondervermögen müssen die erforderlichen Mittel bereitstellen: zur Stärkung der öffentlichen und gemeinnützigen sozialen Infrastruktur, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für Klimagerechtigkeit.
Der Aufruf kann hier heruntergeladen werden.
Falschbehauptung zum Bürgergeld: Ausgaben steigen nicht – sie sinken
Das Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat anhand der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) nachgewiesen: Die Ausgaben für das Bürgergeld sind nicht gestiegen, sondern seit Jahresbeginn 2025 leicht gesunken.
- Gesamt (inkl. Sozialversicherung, Unterkunft, Heizung, kleinere Ansprüche): Ende 2024: 46,923 Mrd. €. Seit Anfang 2025 leicht rückläufig.
- Ohne Sozialversicherung: Ende 2024: 39,876 Mrd. €. In den ersten vier Monaten 2025 Rückgang um 251 Mio. €. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2024 Zuwachs um 1,493 Mrd. €.
- Nur Regelleistungen (ohne Unterkunft/Heizung, ohne Sozialversicherung):Ende 2024: 22,191 Mrd. €. In den ersten vier Monaten 2025 Rückgang um 246 Mio. €. Im gleichen Zeitraum 2024 hingegen Anstieg um 1,050 Mrd. €.
Zusammengefasst:
- 2024: In allen drei Kategorien deutliche Zuwächse in den ersten vier Monaten.
- 2025: Beginn mit einem leichten Rückgang in allen drei Kategorien – trotz steigender Sozialversicherungsaufwendungen.
Harald Thomé kommentiert dies in seinem Newsletter 26/2025: „Die Bundesregierung wie auch die AfD rechtfertigen die geplante Reform des SGB II mit „immer weiter steigenden Kosten“. Die amtlichen Zahlen zeigen jedoch das Gegenteil: Die Ausgaben sinken und die Regierung operiert wissentlich mit falschen Zahlen, um damit ihre Gesetzesverschärfungen zu begründen.“
WSI-Berechnungen zum Lohnabstand: Arbeit lohnt sich immer
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) hat untersucht, ob sich Arbeit gegenüber Bürgergeld lohnt. Ergebnis: Ja – und zwar immer. Selbst im ungünstigsten Fall liegt der Lohnabstand bei 379 Euro. Meist ist der Abstand jedoch deutlich höher.
Vollzeitarbeit zum Mindestlohn führt stets zu mehr verfügbarem Einkommen als Bürgergeld – wenn ergänzende Leistungen wie Wohngeld beantragt werden.
Zur WSI-Untersuchung: hier.
Zusammenfassung im Spiegel: hier.
Wohnkostenlücke 2024
Die Wohnkostenlücke beziffert den Unterschied zwischen den tatsächlichen Kosten der Wohnung und dem, was das Jobcenter real dafür erstattet („angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung“). Die Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten laufenden Kosten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung hat sich im Jahr 2024 insgesamt auf rund 494 Millionen Euro
Aus der Abfrage der Linken: Die Wohnkosten – offiziell als „Bedarfe für Unterkunft und Heizung“ bezeichnet – werden in der Grundsicherung in tatsächlicher Höhe übernommen, sofern sie als angemessen bewertet werden. Die Richtwerte für die Angemessenheit werden kommunal berechnet, was jedoch extrem schwierig ist und immer wieder zu Lücken beim Existenzminimum führt. Diese entstehende „Wohnkostenlücke“ bestreiten die Betroffenen oft aus dem Regelsatz, weil es schlicht keinen günstigeren Wohnraum gibt. Dadurch wird das Existenzminimum unterschritten: Das Geld fehlt dann für Nahrungsmittel, Kleidung, Bildung usw.
Aus der Pressemitteilung der Linken: „334.000 Bedarfsgemeinschaften, also 12,6 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften, bekamen nicht die tatsächlichen Ausgaben für Unterkunft und Heizung erstattet (2023: 12,2 Prozent). Diejenigen, die davon betroffen waren, mussten durchschnittlich rund 116 Euro im Monat (+ 13 % zu 2023: 103 Euro im Monat), rund 17 % der tatsächlichen Kosten (2023: 16 %), aus Regelbedarf oder Ersparnissen selbst finanzieren.“
Die präzise Antwort der Bundesregierung nach Bundesländern und Jobcentern sortiert, finden Sie hier.
Nach Euro sortiert, sind dies die höchsten nicht übernommenen KdU (Durchschnitt pro Monat), nach Städten:
- 252,98 € in Ebersberg
- 252,03 € in Fürstenfeldbruck
- 236,68 € in Oldenburg, Stadt
- 231,42 € in München, Stadt
- 229,38 € in Dachau
- 225,65 € in Treptow-Köpenick
- 205,11 € in Saalfeld-Rudolstadt
- 201,85 € in Potsdam, Stadt
Nach Bundesländern sortiert beträgt der durchschnittliche Nichtübernahmebetrag in Euro:
- 179,69 € in Berlin
- 142,72 € in Bayern
- 121,87 € in Bremen
- 120,64 € in Schleswig-Holstein
- 120,22 € in Brandenburg
Quelle: Harald Thomé/ Newsletter 25/2025 (wir bedanken uns als Verein sehr für die umfangreiche Aufarbeitung des Themas).
Kommentar von Harald Thomé aus seinem Newsletter 25/2025: „Diese erwartbare Steigerung der Wohnkostenlücke drückt in weiten Teilen einen faktisch verfassungswidrigen Zustand aus: Die fehlenden Wohnkosten müssen die Leistungsbeziehenden aus ihrem Regelsatz zahlen. Verfassungswidrig deshalb, weil die Menschen einen abgesicherten Übernahmeanspruch auf die tatsächlichen KdU haben und die örtlichen Jobcenter offensichtlich die angemessenen KdU zu niedrig berechnen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass in den KdU gekürzte Leistungsbeziehende – etwa mit 252 € monatlich in Ebersberg und Fürstenfeldbruck oder 236,68 € in Oldenburg – jeden Monat deutlich weniger zur Verfügung haben. Dieser Betrag liegt deutlich über dem, was das Bundesverfassungsgericht für Sanktionen als zulässig erklärt hat (30 % von 563 € = 168,90 €).
Ich möchte betonen: Es handelt sich bei den genannten Werten um Durchschnittsbeträge. Um einen solchen durchschnittlichen Kürzungsbetrag zu erreichen, müssen die realen Kürzungen in einzelnen Fällen deutlich höher sein. Eigentlich müssten in jedem einzelnen Fall, in dem zwischen 20 und 30 % der Regelleistung zu wenig KdU übernommen werden, von Amts wegen die jeweiligen Fachaufsichten tätig werden und die KdU-Festsetzungen vor Ort prüfen. Diese Zahlen betreffen nur die „Wohnkostenlücke“ im SGB II, eine solche liegt selbstverständlich auch noch im SGB XII vor. Dieser Bereich ist bisher überhaupt nicht beleuchtet, dürfte aber von der Dimension her vergleichbar sein, in Bezug auf die Anzahl der SGB XII-Leistungsbeziehenden.
Schlussfolgerung:
Das Thema Wohnkosten muss stärker in den Blick der Öffentlichkeit und des Gesetzgebers geraten.
Vorschläge zum Umgang damit:
- Ermittlung der angemessenen KdU gemessen an den Angebotsmieten, also an dem Preis, zu dem Unterkünfte tatsächlich zu erhalten sind, und nicht an einem Mischindex aus Bestands- und Angebotsmieten.
- Modifizierung der angemessenen KdU auf die reine Grundmiete, ohne Betriebskosten. Denn Betriebskosten wie gemeinsamer Energieverbrauch, Abwasser oder Grundsteuer liegen nicht in der Einflussmöglichkeit der Leistungsbeziehenden.
- Gesetzliche Regelung, dass Sozialwohnungen immer als angemessen gelten – denn das ist ihr eigentlicher Zweck.
- Sofortige Streichung der Begrenzung der KdU wegen fehlender Umzugserfordernis gemäß § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II. Rückwirkende Zahlung der dahingehenden Kürzungen für Leistungsberechtigte bis Januar des Vorjahres (analog § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II).
- Genehmigungsfiktion für beantragte Unterkünfte im Sinne von § 22 Abs. 4 S. 1 SGB II innerhalb von 3 Werktagen.“